Logik im Schreiben und Denken
Ich werde immer wieder gefragt, wie komplexe Ideen so klar und überzeugend präsentiert werden können, dass sie nicht nur bei dir, sondern auch bei deinen Zuhörenden angemessen in Erinnerung bleiben.
Besonders wenn deine Informationen weitergegeben werden müssen, etwa um Entscheidungen zu treffen, wird deutlich, dass sich ein tieferes Verständnis für Merkfähigkeit und Erinnerungsvermögen lohnt.
Angesichts der enormen Zunahme an Informationen, die wir täglich konsumieren, liegt der Schlüssel in einer wechselseitigen Betrachtung: Was kannst du dir selbst merken, und wie kannst du es anderen erleichtern, sich an deine Botschaft zu erinnern? Diese doppelte Perspektive ist besonders in Beratungssituationen, Präsentationen oder Mitarbeitergesprächen entscheidend, um Informationen effektiv zu vermitteln und nachhaltig im Gedächtnis zu verankern.
Nimm diesen einleitenden Text bisher. Hast du ihn "überflogen" sind drei Absätze schon zuviel, um dich auf mehr Text einzulassen? suchst du in Gedanken schon nach einem Zeitpunkt an dem du Zeit hast weiterzulesen? Würdest du ihn am liebsten bei ChatGPT eingeben, um ihn kürzen zu lassen? Fragen wie diese, diskutiere ich mit vielen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite.
Drei Kommunikationseinheiten: Information, Diskussion und Kreativität
Die meisten Menschen haben es mit drei Austauscheinheiten zu tun, wenn sie miteinander kommunizieren (das betrifft auch die meisten E-Mails):
Informationseinheiten: Kurze, klar strukturierte Fakten oder Daten, die weitergegeben werden, um Wissen zu vermitteln oder Entscheidungen zu erleichtern. Sie sind der Kern von Berichten, Präsentationen oder Updates.
Diskussionseinheiten: Themen oder Fragestellungen, die darauf abzielen, einen Austausch von Ideen, Argumenten oder Perspektiven anzuregen. Sie fördern die Interaktion und helfen, gemeinsames Verständnis oder Lösungen zu entwickeln.
Kreativeinheiten: Inhalte oder Anstöße, die auf Innovation und neue Ansätze abzielen. Sie regen zum Nachdenken an und motivieren, alte Denkmuster zu durchbrechen und neue Lösungen zu finden.
Anhand dieser Einheiten kannst du deine Informationen strukturieren. Besonders in Meetings und Beratungsgesprächen ist es sinnvoll, in der oben dargestellten Reihenfolge vorzugehen. In den meisten Fällen wirst du feststellen, dass du für Diskussionen und kreative Situationen am meisten Zeit benötigst und dabei die Informationsdichte am größten ist.
Der Anstieg der Informationsflut
Studien zeigen, dass wir heute etwa 90-mal mehr Informationen konsumieren als 1940, wobei sich diese Menge in den letzten 20 Jahren vervierfacht hat. Der durchschnittliche Mensch verbringt 82 Stunden pro Woche – rund 69% seiner Wachzeit – mit dem Konsum von Informationen. Besonders E-Mails, soziale Medien und Suchmaschinen tragen zu dieser Informationsflut bei. So widmen Berufstätige etwa 28% ihres Arbeitstags (circa 2,6 Stunden) allein der Bearbeitung von E-Mails. Diese Informationsmenge überfordert häufig unser Arbeitsgedächtnis, das nur 5–9 Informationseinheiten gleichzeitig verarbeiten kann. Die Folge: kognitive Überlastung.
Stell dir vor, du präsentierst wichtige Informationen in einem Meeting oder schreibst eine E-Mail an deine Kollegen. Wie viel von dem, was du sagst oder schreibst, bleibt tatsächlich hängen? Die „Millersche Zahl", benannt nach George Miller, liefert eine wichtige Erkenntnis:
Neuere Forschungen von Nelson Cowan zeigen sogar, dass die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses noch geringer ist – etwa 4 Einheiten. Das bedeutet: Wenn du deinen Kollegen mehr als 4–7 Kernpunkte in einer Präsentation vermittelst, riskierst du, dass wichtige Informationen verloren gehen.
John Swellers Cognitive Load Theory erklärt dieses Phänomen: Effektive Informationsaufnahme findet nur statt, wenn die Gesamtbelastung des Arbeitsgedächtnisses seine Kapazität nicht übersteigt. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Art, wie du Informationen im Arbeitsalltag präsentieren solltest.
Um sicherzustellen, dass deine Botschaften ankommen und im Gedächtnis bleiben, nutze „Chunking" als Werkzeug. Dabei gliederst du komplexe Informationen in überschaubare Einheiten. Du findest dieses Prinzip überall – von gut strukturierten E-Mails bis hin zu benutzerfreundlichen Dashboards.
Wenn du also das nächste Mal eine wichtige Nachricht übermitteln möchtest, denk daran: Weniger ist mehr. Konzentriere dich auf 4–7 Kernpunkte, möglicherweise reiche drei aus, und strukturiere deine Informationen klar und prägnant. So erhöhst du die Chance, dass deine Kollegen sich an deine Botschaft erinnern und sie im Arbeitsalltag umsetzen können.
Das Pyramidenprinzip mach Barbara Minto
In meinen Workshops und Vorträgen höre ich oft die Frage: „Gibt es eine Methode, die uns hilft, Informationen so zu strukturieren, dass sie leichter aufgenommen und erinnert werden können?" Diese Frage ist in unserer informationsüberfluteten Arbeitswelt besonders relevant. Die Antwort führt uns zu einer bemerkenswerten Persönlichkeit: Barbara Minto. Als Pionierin ihrer Zeit brach sie nicht nur als eine der ersten Frauen in die männerdominierte Geschäftswelt ein, sondern entwickelte auch eine wegweisende Methode zur effektiven Kommunikation.
Mintos Ansatz, den ich dir gleich vorstelle, berücksichtigt die Grenzen des menschlichen Arbeitsgedächtnisses und bietet eine praktische Lösung: Du lernst, Informationen so zu organisieren, dass dein Publikum sie leichter verarbeiten und behalten kann. Lass uns einen genaueren Blick auf Barbara Minto und ihre Methode werfen, die die Geschäftskommunikation grundlegend bereichert hat.
Wer ist Barbara Minto?
Barbara Minto hat 1963 Geschichte geschrieben, als sie als eine von nur acht Frauen ihren MBA an der Harvard Business School abschloss. Noch im selben Jahr wurde sie die erste Frau mit MBA-Abschluss, die bei McKinsey & Company eingestellt wurde. Ihre Karriere führte sie von Cleveland nach London, wo sie bis 1973 tätig war. Doch ihre größte Errungenschaft war nicht ihre Karriere bei McKinsey, sondern die Entwicklung eines Kommunikationsprinzips, das die Art und Weise, wie wir denken, schreiben und sprechen, grundlegend verändert hat.
Das Pyramidenprinzip: So funktioniert es
Das Pyramidenprinzip ist Mintos wegweisender und einflussreichster Beitrag zur professionellen Kommunikation. Die Idee dahinter ist so einfach wie brillant in ihrer Wirksamkeit:
Beginne stets mit der zentralen Hauptaussage und baue diese systematisch mit klar strukturierten, logisch aufeinander aufbauenden Argumenten und detaillierten Belegen aus.
Stell dir eine umgedrehte Pyramide vor – an der obersten Spitze steht die prägnante Kernbotschaft, die den Leser sofort orientiert, darunter folgen in hierarchischer Anordnung die unterstützenden Argumente und konkreten Fakten, die diese Botschaft Schicht für Schicht untermauern und verstärken.
Warum ist das so effektiv?
- Klarheit: Leser und Zuhörer verstehen sofort, worum es geht.
- Struktur: Komplexe Inhalte werden leicht nachvollziehbar.
- Effizienz: Du sparst Zeit, da du direkt auf den Punkt kommst.
Tipp für die Praxis: Wenn du deine nächste Präsentation oder ein wichtiges Dokument vorbereitest, frage dich zuerst: Was ist meine Hauptaussage? Ordne dann die unterstützenden Informationen logisch darunter an.
Beispiel: Das Pyramidensystem von Barbara Minto
1. Einleitung mit zentraler Hauptaussage
Kernbotschaft:
„Mit einer klaren Struktur, überzeugender Argumentation und gezielter Interaktion wird jede Präsentation wirkungsvoller und nachhaltiger.“
- Visualisierung: Zeige eine Pyramide mit drei Ebenen: Struktur, Argumentation, Interaktion.
- Einstieg: „Heute zeige ich euch, wie ihr mit drei Ansätzen – Aristoteles’ Dreisatz-Regel, Barbara Mintos Pyramidensystem und dialogorientierten Fragen – überzeugende Präsentationen gestaltet.“
2. Strukturierte Argumente
Argument 1: Aristoteles und die Dreisatz-Regel
- Hauptaussage: „Die Dreisatz-Regel ist die Basis jeder klaren Kommunikation.“
- Unterstützende Punkte:
- Einleitung, Hauptteil, Schluss: Eine universelle Struktur.
- Klarheit und Fokus steigern Überzeugungskraft.
- Historisch bewährt und auch heute noch relevant.
Argument 2: Barbara Minto und das Pyramidensystem
- Hauptaussage: „Mintos Methode bringt komplexe Inhalte auf den Punkt.“
- Unterstützende Punkte:
- Informationen von oben nach unten hierarchisch anordnen.
- Hauptaussage zuerst, Details folgen geordnet.
- Erleichtert die Verständlichkeit und Fokussierung auf Wesentliches.
Argument 3: Dialogorientierte Fragen
- Hauptaussage: „Fragen aktivieren das Publikum und schaffen Engagement.“
- Unterstützende Punkte:
- Fördern Aufmerksamkeit und Partizipation.
- Geben dem Publikum Raum für Reflexion.
- Erleichtern die Verankerung der Kernbotschaft.
3. Detaillierte Belege
Beleg zu Aristoteles und die Dreisatz-Regel:
- Fakt: Studien zeigen, dass Informationen in einer 3-teiligen Struktur leichter erinnert werden.
- Beispiel: Berater-Präsentationen folgen oft dieser Struktur – klare Einleitung, überzeugender Hauptteil, prägnanter Abschluss.
Beleg zu Mintos Pyramidensystem:
- Fakt: Eine hierarchische Struktur reduziert die kognitive Belastung des Publikums.
- Beispiel: Unternehmenspräsentationen großer Beratungsfirmen nutzen Minto, um komplexe Daten verständlich darzustellen.
Beleg zu dialogorientierten Fragen:
- Fakt: Aktives Fragen erhöht die Interaktion und Gedächtnisleistung um bis zu 30 %.
- **Beispiel:**TED-Talk-Redner nutzen wirkungsvolle Fragen wie „Was war der Moment in deinem Leben, der dich grundlegend verändert hat?" oder „Wie stellst du dir eine Welt vor, in der dieses Problem nicht mehr existiert?" um ihr Publikum zum Nachdenken anzuregen.
4. Schlussfolgerung und Handlungsaufforderung
Zusammenfassung:
- Die Dreisatz-Regel gibt euch eine bewährte Grundstruktur.
- Das Pyramidensystem hilft, Inhalte effektiv aufzubereiten.
- Dialogorientierte Fragen schaffen eine Verbindung zum Publikum.
Handlungsaufforderung:
- „Probiert es aus!“ Nutzt diese drei Ansätze bei eurer nächsten Präsentation, um Klarheit, Struktur und Engagement zu fördern.
- Ausblick: „Nutze diese Prinzipien, um durch strukturierte Kommunikation und gezielten Dialog zu überzeugen."
Visuelle Gestaltung
- Einleitung: Eine große, zentrale Folie (Plakat, Miroboard usw.) mit der Kernbotschaft, die direkt ins Auge springt.
- Argumente:
- Jede Ebene der Pyramide als separate Folie, von der Spitze bis zur Basis.
- Nutze Diagramme oder Icons (z. B. ein Buch für Aristoteles, eine Pyramide für Minto, ein Fragezeichen für Fragen).
- Belege: Stichpunkte mit Zahlen und Beispielen, unterstützt durch Bilder oder Grafiken.
- Schlussfolgerung: Eine klare Folie mit einem motivierenden Call-to-Action und Platz für Fragen.
MECE-Prinzip: Strukturierte Informationen auf den Punkt bringen
Ein weiterer zentraler Ansatz Mintos ist das MECE-Prinzip – das steht für „Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive“. Übersetzt bedeutet das, Informationen so zu gruppieren, dass sie sich nicht überschneiden und dennoch vollständig sind.
Ein Beispiel aus der Praxis: Stell dir vor, du arbeitest an einer Marktanalyse. Mithilfe des MECE-Prinzips kannst du sicherstellen, dass du alle relevanten Bereiche abdeckst (z. B. Marktgröße, Wettbewerb, Trends), ohne dass sich die Inhalte doppeln.
Das MECE-Prinzip Beispiel 1
Ein Leitfaden für klare und strukturierte Präsentationen
1. Einleitung mit zentraler Hauptaussage
Hauptaussage:
„Das MECE-Prinzip (Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive) ist der Schlüssel, um Informationen klar und vollständig zu organisieren, Redundanzen zu vermeiden und strukturiert zu kommunizieren.“
- Erklärung des MECE-Prinzips:
- Mutually Exclusive: Jede Kategorie oder Information steht für sich allein – keine Überschneidungen.
- Collectively Exhaustive: Zusammen decken die Kategorien das gesamte Thema ab – keine Lücken.
- Bedeutung:
- MECE sorgt für Präzision, Klarheit und Vollständigkeit, besonders in komplexen Präsentationen oder bei Problemanalysen.
2. Definition der MECE-Komponenten
A. Mutually Exclusive (Gegenseitiger Ausschluss):
- Informationen oder Kategorien überschneiden sich nicht.
- Beispiel: Die drei Themen unserer Präsentation – Aristoteles’ Dreisatz-Regel, Mintos Pyramidensystem, dialogorientierte Fragen – sind klar voneinander abgegrenzt.
B. Collectively Exhaustive (Vollständige Abdeckung):
- Zusammen decken die Informationen alle relevanten Aspekte des Themas ab.
- Beispiel: Diese drei Ansätze behandeln Struktur, Argumentation und Interaktion, wodurch eine vollständige Perspektive auf erfolgreiche Präsentationstechniken entsteht.
3. Anwendung des MECE-Prinzips
Beispiel zur Informationsgruppierung:
Zentrales Thema: Erfolgreiche Präsentationstechniken.
- Mutually Exclusive Kategorien:
- Aristoteles und die Dreisatz-Regel: Die Basis einer klaren Struktur.
- Barbara Minto und das Pyramidensystem: Die Kunst, Inhalte logisch zu organisieren.
- Dialogorientierte Fragen: Methoden, um Interaktion und Engagement zu fördern.
- Collectively Exhaustive Abdeckung:
- Diese drei Kategorien decken die zentralen Aspekte einer gelungenen Präsentation ab: Struktur, Argumentation, Interaktion.
4. Vorteile des MECE-Prinzips
A. Effektivität in Analyse und Problemlösung:
- Klarheit: Das Publikum kann die Informationen leichter verstehen und verarbeiten.
- Effizienz: Keine Zeitverschwendung durch Wiederholungen oder fehlende Informationen.
B. Vermeidung logischer Fehler:
- Überschneidungen oder Lücken in der Argumentation werden ausgeschlossen.
C. Übersichtlichkeit bei komplexen Themen:
- Komplexe Inhalte lassen sich in handhabbare Teile zerlegen, die miteinander kohärent sind.
- Beispiel: Eine Unternehmensanalyse könnte mit MECE die Bereiche Finanzen, Strategie und Mitarbeitertrennen, um eine vollständige Bewertung zu ermöglichen.
5. Schlussfolgerung und Handlungsaufforderung
Zusammenfassung:
- Das MECE-Prinzip hilft, Informationen klar und strukturiert zu organisieren.
- Es vermeidet Redundanzen und deckt alle relevanten Aspekte eines Themas ab.
Handlungsaufforderung:
- „Probiert das MECE-Prinzip in eurer nächsten Präsentation aus: Trennt eure Inhalte in klare Kategorien und sorgt dafür, dass keine wichtigen Punkte fehlen.“
Ausblick:
- Vertiefende Übungen: Übt, eine Themenliste nach MECE zu organisieren.
- Beispiele aus eurem Alltag: Wie könnt ihr dieses Prinzip bei Berichten, Analysen oder Meetings anwenden?
Visuelle Gestaltung:
- Einleitung: Eine klare Darstellung des MECE-Prinzips als Diagramm oder Tabelle.
- Komponenten: Verwende zwei Spalten (ME & CE), um Unterschiede und Beispiele gegenüberzustellen.
- Anwendung: Visualisiere die drei Themen (Dreisatz, Pyramide, Fragen) als unabhängige Boxen, die gemeinsam das zentrale Thema abdecken.
- Vorteile: Listenform mit Icons für Klarheit, Effizienz und Übersichtlichkeit.
- Schluss: Eine auffällige Folie mit Call-to-Action, z. B. „Wendet MECE in eurer Arbeit an!“
Das MECE-Prinzip Beispiel 2
Präzise Kommunikation mit klaren Aussagen und Fragen
1. Einleitung mit zentraler Hauptaussage
Hauptaussage:
„Das MECE-Prinzip (Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive) ist der Schlüssel zu präziser und vollständiger Kommunikation. Es hilft, Aussagen und Fragen so zu strukturieren, dass sie klar, relevant und vollständig sind.“
- Erklärung des MECE-Prinzips:
- Mutually Exclusive (ME): Jede Information ist einzigartig und überschneidet sich nicht mit anderen.
- Collectively Exhaustive (CE): Gemeinsam decken die Informationen das gesamte Thema ab, ohne Lücken zu hinterlassen.
- Bedeutung:
- MECE sorgt für Logik, Klarheit und Effektivität in der Kommunikation, insbesondere bei der Entwicklung von Fragen und Aussagen.
2. Definition der MECE-Komponenten
A. Mutually Exclusive (Gegenseitiger Ausschluss):
- Definition: Jede Aussage oder Frage ist eigenständig und behandelt einen einzigartigen Aspekt.
- Beispiel:
- Aussage: „Das MECE-Prinzip verbessert die Klarheit in der Kommunikation.“
- Geschlossene Frage: „Verwendet ihr das MECE-Prinzip in euren Präsentationen?“
- Offene Frage: „Wie könntet ihr das MECE-Prinzip in eurer Kommunikation anwenden?“
B. Collectively Exhaustive (Vollständige Abdeckung):
- Definition: Zusammen ergeben die Aussage und die Fragen ein vollständiges Bild.
- Beispiel:
- Die Aussage gibt die Grundlage.
- Die geschlossene Frage prüft eine spezifische Tatsache.
- Die offene Frage lädt zur Reflexion und Diskussion ein.
3. Anwendung des MECE-Prinzips
Beispiel zur Informationsgruppierung:
Zentrales Thema: Die Bedeutung von präzisen Aussagen und Fragen in der Kommunikation.
- Mutually Exclusive Kategorien:
- Aussage: Informiert und setzt den Rahmen.
- Geschlossene Frage: Prüft konkrete Fakten oder Zustimmung.
- Offene Frage: Fördert Reflexion und kreative Lösungsansätze.
- Collectively Exhaustive Abdeckung:
- Diese drei Elemente arbeiten zusammen, um Information zu vermitteln, Feedback einzuholen und Diskussionen zu ermöglichen.
4. Vorteile des MECE-Prinzips
A. Effektivität in der Kommunikation:
- Klarheit: Das Publikum versteht die Botschaften sofort.
- Fokus: Fragen und Aussagen bleiben zielgerichtet und relevant.
B. Strukturierte Informationsvermittlung:
- Jede Aussage und Frage hat eine eindeutige Funktion.
- Redundanzen werden vermieden, und die Kommunikation wird effizienter.
C. Förderung von Engagement:
- Geschlossene Fragen aktivieren Zustimmung oder spezifische Antworten.
- Offene Fragen regen zum Nachdenken an und schaffen Interaktion.
5. Schlussfolgerung und Handlungsaufforderung
Zusammenfassung:
- Eine klare Aussage bildet die Basis der Kommunikation.
- Geschlossene Fragen prüfen Fakten oder Zustimmungen.
- Offene Fragen fördern Engagement und Reflexion.
- Das MECE-Prinzip hilft, diese Elemente strukturiert und effektiv einzusetzen.
Handlungsaufforderung:
- „Integriert das MECE-Prinzip in eure Gespräche, Präsentationen und Diskussionen. Achtet darauf, dass eure Aussagen und Fragen klar, relevant und vollständig sind.“
Ausblick:
- Praktische Übungen: Entwickelt eine Aussage und zwei Fragen, die nach MECE strukturiert sind.
- Anwendung im Alltag: Nutzt das Prinzip bei Meetings, Workshops oder Feedbackgesprächen.
Visuelle Gestaltung:
- Einleitung: Diagramm mit einer Pyramide, die Aussage, geschlossene Frage und offene Frage als klare Ebenen zeigt.
- Definition: Zwei Spalten für ME und CE, mit Beispielen für jede Kategorie.
- Anwendung: Darstellung der drei Kategorien in einer Tabelle oder einer visuellen Matrix.
- Vorteile: Listenform mit Icons (z. B. Sprechblase für Fragen, Häkchen für Klarheit).
- Schluss: Eine klare Call-to-Action-Folie, z. B. „Strukturiert eure Kommunikation mit MECE!“
Mit dieser Struktur und klarer Visualisierung wird das MECE-Prinzip praxisnah und nachvollziehbar vermittelt.
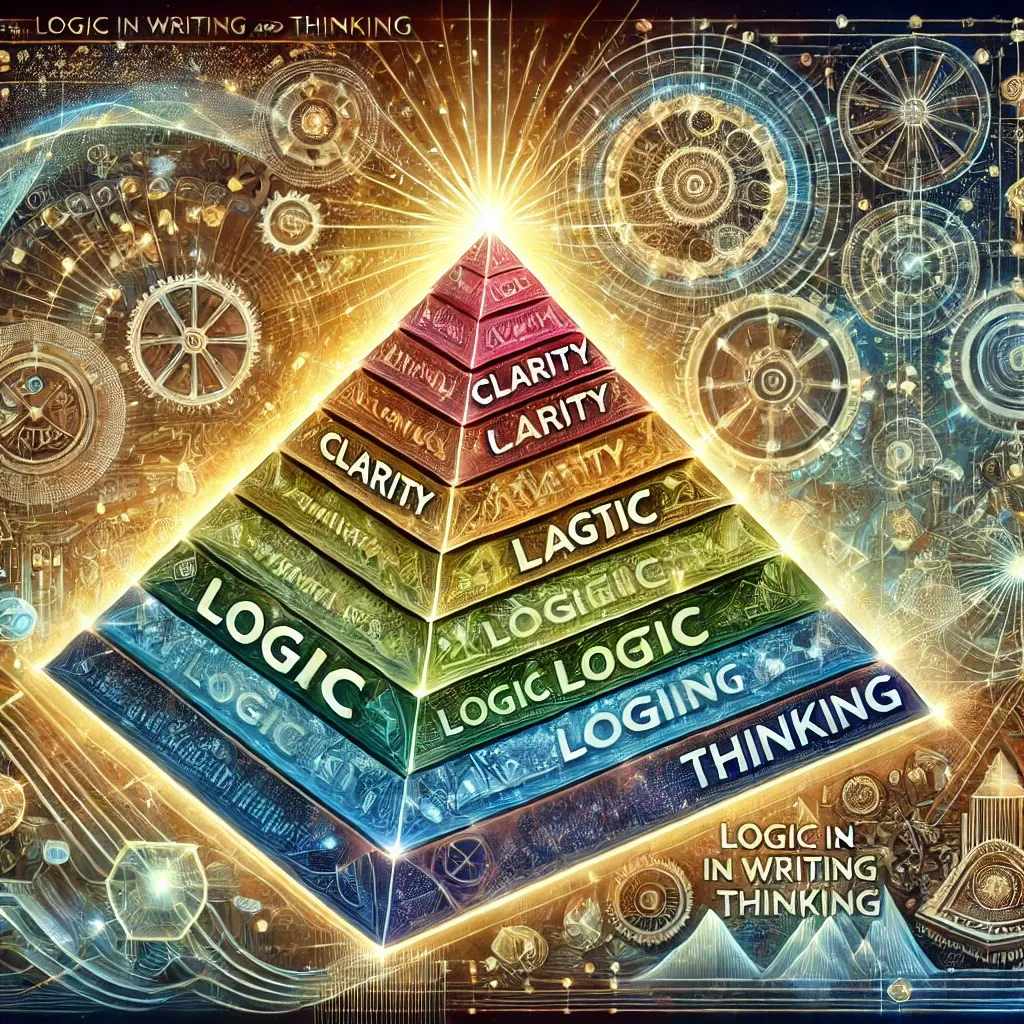
The Pyramid Principle
Logic in Writing and Thinking
Zusammenfassung: The Pyramid Principle
Logic in Writing and Thinking
Barbara Mintos 1985 erschienenes Buch „The Pyramid Principle: Logic in Writing, Thinking and Problem Solving" gilt als Standardwerk für klare Kommunikation. Als Klassiker bietet es Beratern, Verkäufern und Präsentatoren wertvolle Werkzeuge für strukturierte und überzeugende Kommunikation. Die Methoden finden weltweit Anwendung in Unternehmensberatungen und Führungsetagen, während Minto selbst bis heute in kleinen Gruppen Schulungen zur effektiven Kommunikation durchführt.
Die Kernidee: Das Pyramidenprinzip
Mintos zentrales Konzept ist die Pyramidenstruktur für Texte und Präsentationen. Die Hauptaussage steht an der Spitze, darunter gruppieren sich logisch die unterstützenden Argumente und Details. Diese Struktur entspricht der Art und Weise, wie unser Gehirn Informationen am besten aufnimmt und verarbeitet.
Klarere Kommunikation
Du lernst, deine Gedanken so zu strukturieren, dass deine Zuhörer oder Leser dir mühelos folgen können. Das Pyramidenprinzip hilft dir, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen.
Effektiveres Schreiben
Minto zeigt dir, wie du deine Texte von Grund auf logisch aufbaust. Du sparst Zeit beim Schreiben und Überarbeiten, weil du von Anfang an eine klare Struktur hast.
Überzeugende Argumentation
Die Methode unterstützt dich dabei, deine Argumente schlüssig zu präsentieren. Du lernst, wie du induktive und deduktive Logik gezielt einsetzt.
Problemlösungskompetenz
Das Buch vermittelt dir Techniken, um komplexe Probleme zu analysieren und strukturiert anzugehen. Diese Skills sind in Beratung und Management Gold wert.
Praktische Anwendung
Minto gibt dir konkrete Anleitungen an die Hand:
- Wie du eine packende Einleitung schreibst
- Wie du Hauptaussagen und Unterpunkte logisch gruppierst
- Wie du visuelle Elemente effektiv einsetzt
Sie illustriert ihre Methoden mit vielen Beispielen, sodass du sie direkt in deiner täglichen Arbeit umsetzen kannst.
"The Minto Pyramid Principle" lohnt sich für alle, die beruflich viel schreiben, präsentieren oder komplexe Sachverhalte vermitteln müssen. Die hier vermittelten Techniken werden deine Kommunikationsfähigkeiten deutlich verbessern.
Du wirst erleben, wie deine Texte und Präsentationen klarer, überzeugender und wirkungsvoller werden. Deine Zuhörer und Leser werden die Klarheit und Struktur deiner Botschaften zu schätzen wissen.
Obwohl das Buch nicht mehr ganz neu ist, sind seine Prinzipien zeitlos – und in unserer informationsüberfluteten Welt wichtiger denn je. Die Zeit, die du in die Lektüre und Anwendung der Methoden investierst, wird sich in deiner täglichen Arbeit schnell auszahlen.
Quellenangaben
- Minto, B. (1996). The Minto Pyramid Principle: Logic in Writing, Thinking and Problem Solving. Minto International.
- McKinsey & Company. (n.d.). Barbara Minto: "MECE: I invented it, so I get to say how to pronounce it". McKinsey Alumni News.
- Gray, R. (n.d.). Communicate Effectively with MECE and the Pyramid Principle. LinkedIn.
- Carat & Deepwater Asset Management. (n.d.). Study on information consumption.
- McKinsey & Company. (n.d.). Analysis of email usage in the workplace.
- Google. (n.d.). Statistics on search queries.
- Firth, J., Torous, J., Stubbs, B., Firth, J. A., Steiner, G. Z., Smith, L., ... & Sarris, J. (2019). The "online brain": how the Internet may be changing our cognition. World Psychiatry, 18(2), 119-129.
- Sparrow, B., Liu, J., & Wegner, D. M. (2011). Google effects on memory: Cognitive consequences of having information at our fingertips. Science, 333(6043), 776-778.
- Eppler, M. J., & Mengis, J. (2004). The concept of information overload: A review of literature from organization science, accounting, marketing, MIS, and related disciplines. The Information Society, 20(5), 325-344.
- Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M. (1968). Human memory: A proposed system and its control processes. Psychology of Learning and Motivation, 2, 89-195.
- Sweller, J. (2005). Implications of cognitive load theory for multimedia learning. The Cambridge Handbook of Multimedia Learning, 19-30.
- Microsoft. (2015). Study on attention spans.
- Pew Research Center. (2018). Social media use in 2018.
- Sharifian, N., & Zahodne, L. B. (2020). Social media bytes: Daily associations between social media use and everyday memory failures across the adult life span. Journals of Gerontology: Psychological Sciences, 75(3), 540-548.
- Ward, A. F., Duke, K., Gneezy, A., & Bos, M. W. (2017). Brain drain: The mere presence of one's own smartphone reduces available cognitive capacity. Journal of the Association for Consumer Research, 2(2), 140-154.











